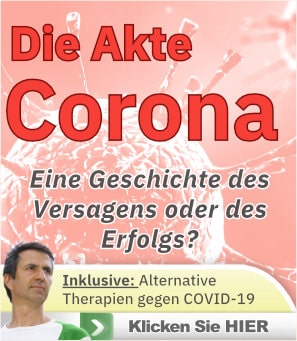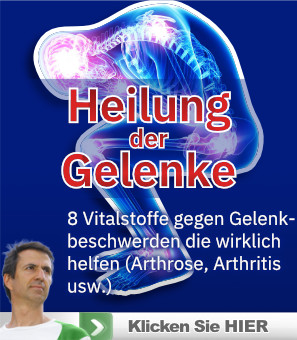Amiodaron ist ein starkes Medikament. Es wird eingesetzt, wenn das Herz völlig aus dem Takt gerät – vor allem bei schwer behandelbaren Rhythmusstörungen. Man könnte sagen: Amiodaron ist kein Alltagsmittel, sondern ein Notfallwerkzeug. Doch dieses Werkzeug hat es in sich.
Der Wirkstoff ist chemisch betrachtet ein sogenanntes Benzofuran-Derivat mit besonders hoher Jodbelastung – jedes Molekül enthält zwei Jodatome. Auf den ersten Blick klingt das harmlos. Doch genau dieses Jod ist es, das dem Körper auf Dauer zu schaffen macht.
Warum die Schilddrüse besonders leidet
Unsere Schilddrüse ist ein sensibles Organ. Sie braucht zwar Jod, um Hormone herzustellen – aber zu viel davon kann die gesamte Steuerung durcheinanderbringen. Und genau das passiert unter Amiodaron: Die enorme Jodmenge aus dem Medikament überflutet den Körper und bremst paradoxerweise die Schilddrüsenfunktion aus. Das nennt man eine „amiodaroninduzierte Hypothyreose“, also eine durch das Medikament ausgelöste Schilddrüsenunterfunktion.
Das Problem dabei:
Der Körper kann in dieser Situation kein zusätzliches Jod aufnehmen – weil Amiodaron die Transportwege blockiert. Gleichzeitig ist die Schilddrüse überfordert, weil sie längst mit Jod überversorgt ist. Ein Teufelskreis entsteht.
Bei manchen Patienten geschieht sogar das Gegenteil: Eine sogenannte amiodaroninduzierte Thyreotoxikose, also eine Schilddrüsen-Überfunktion, bei der zu viele Hormone ausgeschüttet werden. Gerade bei vorgeschädigtem Herzmuskel kann das lebensgefährlich werden – denn die Überfunktion beschleunigt den Herzschlag, erhöht den Energieverbrauch und bringt das Herz weiter aus dem Takt.
Auch Leber, Nerven und Haut reagieren empfindlich
Neben der Schilddrüse leidet bei vielen Patienten auch die Leber. Bei der Hälfte der Betroffenen steigen die Leberwerte deutlich an. In schlimmeren Fällen entwickelt sich eine Art „medikamentöse Hepatitis“ – mit Symptomen wie Müdigkeit, Übelkeit, Druck im Oberbauch und allgemeiner Schwäche. Auch Hautveränderungen, Nervenschäden und Magen-Darm-Beschwerden sind möglich. Die Nebenwirkungen betreffen den ganzen Organismus – sie sind nicht die Regel, aber auch nicht selten.
Dazu kommen zahlreiche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten – insbesondere mit Betablockern, Gerinnungshemmern (wie Marcumar) oder Antidepressiva. Amiodaron beeinflusst nämlich den Abbau vieler Arzneimittel über das sogenannte CYP450-System in der Leber. Dadurch kann es zu einer gefährlichen Wirkungsverstärkung kommen – bis hin zur Überdosierung.
Einzige gute Nachricht: Eine problematische Wechselwirkung mit dem Schmerzmittel Metamizol ist nicht bekannt, da dieses über andere Stoffwechselwege abgebaut wird.
Was tun bei Schilddrüsenunterfunktion durch Amiodaron?
Eine Leserin schrieb mir:
„Gibt es von Ihnen einen Bericht darüber, wie man eine Schilddrüsenunterfunktion, die von Amiodaron verursacht wird, erfolgreich behandelt? Das Problem ist ja, dass Amiodaron die Jod-Aufnahme blockiert, da es selbst viel zu viel synthetisches Jod enthält.“
Das ist eine wichtige und berechtigte Frage. Tatsächlich gibt es zwei große Herausforderungen bei der Behandlung:
- Die Jodblockade: Amiodaron hemmt über das sogenannte Wolff-Chaikoff-Phänomen die Jodverwertung – als Reaktion auf die Überflutung mit Jod. Das bedeutet: Selbst wenn der Körper theoretisch mehr Schilddrüsenhormone produzieren möchte, wird er durch die Jodlast ausgebremst.
- Die Schilddrüse ist erschöpft: Manche Patienten entwickeln unter Amiodaron eine Art „funktionelle Starre“ – die Schilddrüse zieht sich sozusagen zurück und verweigert die Arbeit.
Therapieansatz in der Praxis:
– In den meisten Fällen wird L-Thyroxin (T4) verabreicht, um den Mangel auszugleichen. Wichtig ist eine engmaschige Kontrolle der Werte – insbesondere TSH, fT3 und fT4.
– Bei älteren Patienten oder Menschen mit Herzschwäche beginnt man mit sehr niedrigen Dosen (z. B. 12,5 µg täglich), um das Herz nicht zu überlasten.
– Manche Patienten profitieren von einer Kombinationstherapie aus T4 und T3 – dies sollte jedoch individuell abgewogen werden.
– Zusätzlich hilfreich: Selen (100–200 µg täglich), um die Umwandlung von T4 in das aktive T3 zu unterstützen.
– Wenn möglich und vertretbar, wird Amiodaron reduziert oder ganz abgesetzt – das sollte aber immer mit einem Kardiologen abgestimmt werden.
Die vollständige Normalisierung der Schilddrüsenfunktion kann Wochen bis Monate dauern. Manche Patienten bleiben dauerhaft auf Schilddrüsenhormone angewiesen.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Dieser Beitrag wurde letztmalig am 24.7.2025 vollständig überarbeitet.
Beitragsbild: pixabay.co – Pexels